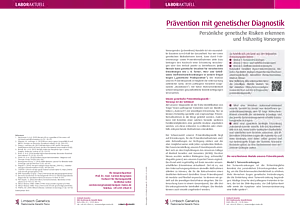Wer seine genetischen Risikofaktoren kennt, kann handeln.
Jeder von uns hat seine individuelle genetische Prädisposition, die das Risiko für bestimmte Erkrankungen beeinflusst. Wir kennen heute viele Gene, deren pathogene Veränderungen adressierbare Erkrankungen verursachen oder Krankheitsrisiken erhöhen. Sind solche Genveränderungen bekannt, ist eine zielgerichtete medizinische Vorsorge möglich.
Unser modulares Präventionspanel
Unser Präventionspanel haben wir modular aufgebaut; die Gen-Auswahl orientiert sich an den Empfehlungen des „American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)“, die wir gezielt um weitere „actionable genes“ (medizinisch angehbare Gene) erweitert haben und regelmäßig anhand der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisieren.
Erkrankungen vermeiden, Risiken minimieren:
- Regelmäßig an Vorsorge-/Screening-Untersuchungen teilnehmen
- Bekannte Krankheitsauslöser (möglichst) vermeiden
- Risiko durch medikamentöse Behandlung und nicht-medikamentöse Maßnahmen verringern
- Verfügbare Behandlungsansätze zielgerichtet auswählen
Für uns zentrale Kriterien sind, dass:
- Veränderungen in den untersuchten Genen bekanntermaßen die Erkrankung auslösen oder das Risiko dafür erheblich steigern (hohe Penetranz).
- die Erkrankung möglicherweise viele Jahre symptomlos – und damit wahrscheinlich auch unerkannt – bleibt.
- sich aus den Ergebnissen der genetischen Untersuchung konkrete Maßnahmen für Früherkennung, Vorsorge und/oder Therapie ableiten lassen.
Individuell und flexibel dank Modularität
Unser Präventionspanel haben wir modular aufgebaut, um zielgerichtet und flexibel auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche eingehen zu können. Die Module des Panels sind in drei Krankheitsgruppen eingeteilt: Tumorerkrankungen (Modul 1), Herz- und Gefäßerkrankungen (Modul 2) und Stoffwechselerkrankungen (Modul 3).
Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser ist die Prognose. Heute sind verschiedene Screening-Programme zur Früherkennung Teil der regelhaften Gesundheitsversorgung. Diese Maßnahmen sind auf das Risiko in der Allgemeinbevölkerung abgestimmt. Allerdings ist für Personen mit einem Tumordispositionssyndrom oder einer familiären Krebserkrankung das Risiko für bestimmte Krebsarten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht.
Mit der im Modul 1 getroffenen Gen-Auswahl untersuchen wir gezielt, ob genetische Veränderungen in Genen vorliegen, die für die Entstehung von erblichem Brust- und Eierstockkrebs, Prostatakarzinom, Magen- und Darmkrebs, Hautkrebs, Leukämien und weiteren Tumorerkrankungen besonders relevant sind. Stellen wir ein erhöhtes Risiko für eine spezifische Krebserkrankung fest, ist es sinnvoll, früh und regelmäßig an Früherkennungsmaßnahmen teilzunehmen. Kommt es zum Krankheitsausbruch, kann dann frühzeitig mit der Behandlung begonnen werden.
Herzrhythmusstörungen, Herzmuskel- und Gefäßerkrankungen, z. B. eine Erweiterung der Hauptschlagader (Aortenaneurysma) – sie alle können genetische Ursachen haben. Oft bleiben diese Erkrankungen unerkannt und unbehandelt. Zu den möglichen gesundheitlichen Risiken gehören Herzschwäche, plötzlicher Herztod oder eine lebensbedrohliche Aneurysmaruptur.
Genetisch bedingte Herz- und Gefäßerkrankungen können derzeit meist nicht unmittelbar geheilt, aber fast immer gut medikamentös oder operativ behandelt werden. Auch eine engmaschige Überwachung kann dazu beitragen, die Risiken einer angeborenen Herz- und Gefäßerkrankung zu verringern.
Die meisten der im Modul 2 untersuchten Erkrankungen werden autosomal-dominant vererbt, d. h. das Risiko für Betroffene, die Erkrankung an die eigenen Kinder weiterzugeben, liegt bei 50 %. Wird im Rahmen der Untersuchung eine krankheitsverursachende Veränderung entdeckt, können die Ergebnisse der genetischen Untersuchung deswegen auch für Eltern, Geschwister und Kinder relevant sein.
Bei diesem Modul können einzelne der nachfolgend gelisteten Erkrankungen ausgeschlossen werden, um die Analyse an individuelle Bedürfnisse und Wünsche anzupassen.
Familiäre Hypercholesterinämie (FH)
Bei der FH ist der LDL-Cholesterin-Spiegel im Blut erblich-bedingt teils massiv erhöht. Kommt es durch überschüssiges LDL-Cholesterin zu Lipidablagerungen, begünstigt dies eine Gefäßverhärtung (Atherosklerose), die ein Risikofaktor für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist.
(Be-)Handlungsoption: LDL-Cholesterin-Spiegel (medikamentös) senken
Diabetes Typ MODY (Maturity-onset diabetes of the young)
Anders als Diabetes Typ 1 (Autoimmunerkrankung) und Typ 2 (Insulinresistenz), ist der Diabetes vom Typ MODY genetisch bedingt. Oft tritt die Erkrankung im jungen Erwachsenenalter auf (< 35 Jahre) und verläuft milder als andere Diabetes-Typen. Für die Wahl einer individuell-abgestimmten Behandlung ist es wichtig, den Typ MODY von anderen Diabetes-Formen unterscheiden zu können und die genaue genetische Ursache zu kennen.
(Be-)Handlungsoption: je nach zugrundeliegender genetischer Veränderung und Krankheitsverlauf Diät, Bewegung, Sulfonylharnstoffe, Antidiabetika, Insulin
Maligne Hyperthermie (Narkoseunverträglichkeit)
Hier handelt es sich um eine sehr seltene, aber gefährliche mögliche Narkose-Komplikation. Bei entsprechender genetischer Veranlagung kann es bei Kontakt mit bestimmten Narkosemitteln zu unkontrollierter Calcium-Freisetzung in der Skelettmuskulatur kommen. Die namensgebende „bösartige Überwärmung“ (maligne Hyperthermie) des Körpers ist ein typisches Symptom.
(Be-)Handlungsoption: sicheres Narkosemittel verwenden
Hereditäre Hämochromatose (Eisenspeicherkrankheit)
Bei der hereditären Hämochromatose kommt es zu einer krankhaft gesteigerten Aufnahme von Eisen und dessen Ansammlung in verschiedenen Organen, insbesondere in der Leber. Die exzessive Eisen-Speicherung kann Schäden in verschiedenen Organen und Geweben verursachen (z. B. Leber, Pankreas, Herz, Gelenke, Hypophyse, Milz, Schilddrüse und Haut). Durch frühzeitige Erkennung und Behandlung lassen sich mögliche Schäden vermeiden/verringern.
(Be-)Handlungsoption: wiederholt venöses Blut entnehmen („Aderlass“)
Morbus Wilson (Kupferspeicherkrankheit)
Bei Morbus Wilson kann überschüssiges Kupfer nicht aus der Leber abtransportiert werden. Eine „Überladung“ der Leber mit Kupfer kann sich durch Leber-Schädigung und Störung der Leber-Funktion äußern. Tritt ungebundenes Kupfer schließlich aus und lagert sich in anderen Organen und Geweben ab, können diese ebenfalls geschädigt werden.
(Be-)Handlungsoption: Kupferaufnahme reduzieren, Kupferausscheidung steigern
Wie läuft die präventive genetische Untersuchung ab?
Laut Gendiagnostikgesetz (GenDG) darf eine präventive genetische Untersuchung bei gesunden Personen nur von einem Facharzt oder einer Fachärztin für Humangenetik angefordert werden.
Beratungsgespräch
Vor der Untersuchung ist ein ausführliches genetisches Beratungsgespräch notwendig. Damit ermöglichen wir Ratsuchenden eine aufgeklärte, eigenständige und fundierte Entscheidung zu treffen, ob sie eine präventive genetische Analyse wünschen. Das Beratungsgespräch kann persönlich oder im Rahmen einer Videosprechstunde stattfinden. Liegt im Anschluss die schriftliche Einwilligung in die genetische Untersuchung vor, erfolgt die Probennahme; in der Regel genügen bereits 3 – 5 ml Blut.
Auswertung und Information
Nach Analyse und Auswertung erstellen wir einen Befund, der mit dem/der aufklärenden Fachärzt:in im Rahmen eines Befundmitteilungsgespräches ausführlich besprochen wird. Der Befund selbst ist klar strukturiert und erklärt die Ergebnisse verständlich. Werden krankheitsverursachende genetische Veränderungen nachgewiesen, geben wir sowohl im Gespräch als auch im Befund konkrete Handlungsempfehlungen und eine Risikoeinschätzung für weitere Familienmitglieder und Kinder der/des Ratsuchenden.
Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL)
Präventive genetische Untersuchungen sind nicht Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb werden die Kosten nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Es handelt sich um eine individuelle Gesundheitsleistung (IGeL), für die wir auf Grundlage der Amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) einen Kostenvoranschlag und eine Rechnung stellen.